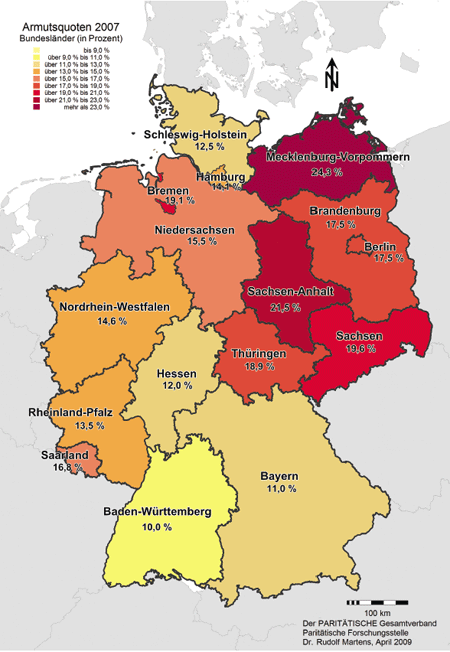68, Kurras, Stasi – muss die Geschichte neu geschrieben werden?
Muss die Geschichte von 68, dem Tod Benno Ohnesorgs, der studentischen Protestbewegung neu geschrieben werden? Und wichtiger: Hatte Karl-Heinz Kurras vom MfS den Auftrag bekommen, Ohnesorg zu töten? Oder irgendwen anders? Und wenn ja, zu welchem Zweck?Und viel mehr noch: Lässt sich Geschichte vorhersehen, um dann zum richtigen Zeitpunkt einzugreifen?
Bei solchen Fragen kristallisiert sich doch schnell heraus: Vieles kann nur auf spekulativer Ebene beantwortet werden und solche Antworten genügen historisch nicht. Sie so unzureichend zu beantworten dämpft oder schürt letztlich nur das Flämmchen, auf dem bestimmet Zeitgenossen ihr politisches Süppchen zu köcheln gedenken. Und dennoch: Reizvoll ist die Beschäftigung mit dem Thema schon – allein, weil wir gewahr werden, dass das MfS der DDR tiefen Einfluss in der Bundesrepublik hatte und die westlichen Dienste dem quasi gar nichts entgegenzusetzen hatten (und – von nichts kommt nichts – unter Berücksichtigung der aktuellen politischen Konstellationen wohl auch weiterhin nur wenig wirkmächtig sind).
Also Spekulationen – keinen Deut wissenschaftlich, persönlich gefärbt und auf keinen Fall haltbar:
Ich stelle fest: Der Freispruch Kurras geschah – so ist anzunehmen – im Unwissen der Justiz von der Mitgliedschaft Kurras´ in SED und MfS. Er war einfach nur Polizist – und er wurde freigesprochen. Heute gilt dieser Freispruch – zumindest in den Medien – nichts mehr. Ich will nicht Kurras verteidigen (da gibt’s nix zu verteidigen). Aber: Ein Polizist darf einen Menschen erschießen und ein Stasi-Man nicht? Was ist denn das für eine zwischen den Zeilen transportierte Logik?
Ich stelle fest: In vielen Institutionen der BRD saßen Stasi-Männer und berichteten „nach drüben“. Logisch – das war ihr Job. Was will ich mich denn darüber aufhalten, dass das so war? Hätte der BRD seine Arbeit richtig gemacht, wäre das nicht passiert. Er hat seine Arbeit ganz offensichtlich nicht oder nicht richtig gemacht. Und dann weiß die Gegenseite halt was. Der Bessere gewinnt. 42 und mehr Jahre danach rumjammern und Wunden lecken hat keinen Zopf.
Wenn ich Alt-68er wäre, würde ich mir jetzt kräftig in den Arsch beißen. Dass das reaktionäre Bullenschwein in Wahrheit ein Mann der eigenen/favorisierten Seite war (und den Stein ins Rollen brachte), müsste ich dann mit Stopfen und Drücken in mein Weltbild integrieren (auf die Gefahr hin, dass es daran zerbirst). Der Feind war ja eigentlich Freund. Nur gewusst hats leider niemand. Fuck. Und ist in beiden Systemen angekommen, bezog von beiden Seiten Geld und ist auch ausgewiesener Waffennarr. Double-Fuck.
An Art und Umfang der Erkenntnisse – sowie am Zeitpunkt ihrer Enthüllung mag man berechtigte Zweifel haben. Am deutlichsten artikuliert die die Linke Zeitung am 25. Mai:Rechtzeitig zum „Geburtstag“ der BRD kam ein Geschenk aus der Birthler Behörde. „Rein zufällig“ seien 2 Mitarbeiter auf mehrere Aktenordner und den SED-Mitgliedsausweis gestoßen, die eine Stasi-Tätigkeit von Kurras belegen soll.“ „
Zugegeben: Der Gedanke hat was für sich. Das aktuelle Gebaren der Koalition (In8ternetsperren, defekte „Reformen“, Überwachung allerorten, kaputte Finanzpolitik…) lässt einen gemischten Eindruck beim Blick auf das Grundgesetz und die BRD zu. Da jetzt ein diabolisches Stasi-Karnickel aus dem Hut zu zaubern, das hat schon was. Und der Zauberere (vulgo Birthler-Behörde) ruft in fetten Lettern: „Hier ist der Beweis!! Wir sind die Guten! Und wir waren auch schon immer die Guten!!“
Ach ja, die Bild-Zeitung. Das ist vielleicht ein Scheißblatt. Gestern (also anno 68) schimpfen sie aus vollstem Rohre über die „langbehaarten Affen“ und heute über den, der auf besagte Affen schoss. Und: Kurras sagt zwar niemandem was, aber die BamS ist wohl auch so eine Art Niemand. Die Erkenntnisse, die sich hieraus haben gewinnen lassen sind aber – mit Verlaub (wie viele durch Bild verbreitete Erkenntnisse) eher dürftiger Natur. Was Neues? Fehlanzeige. Nur, dass Kurras nichts bereut. Aus seiner Perspektive gesehen verständlich. Das hätte man sich aber auch so denken können…
Geschichte neu schreiben? Nö, zumindest noch nicht. Denn erstens ist ja nicht erwiesen, dass Kurras aus Anweisung der Stasi schoss. Daran glaubt außer Herrn Aust niemand so recht. Außerdem: Es wird zwar landläufig davon ausgegangen, dass der Tod Benno Ohnesorgs zur Radikalisierung der damaligen Studenten und so auch zur RAF führte, doch wer wollte das stringent beweisen? Es ist noch lange nicht gesagt, dass nicht ein anderer Auslöser oder eine Summe aus verschiedenen Auslösern einen ähnlichen Effekt gehabt hätte. Hätte die Stasi das absehen – ja gar planen können? Die Aktion hätte scheitern – wenn nicht gar nach hinten losgehen können. Und: In der Wahrnehmung war der DDR-Apparat doch eher bürgerlich-reaktionär. Will man das MfS durch eine solche analytische Schärfe „adeln“? Ich denke, nein. Ungewollt geschieht das aber immer dann, wenn man unterstellt, dass sie den Mord an Ohnesorg eingefädelt hätte, um die damalige BRD durch die nun losgetretenen Proteste zu schwächen. Auch ist die Zielsetzung zu neblig, als das man das sinnigerweise unterstellen könnte.
Den Lattenkracher liefert aber Meinhof-Tochter Bettina Röhl im Welt-Blog (nicht vergessen: Auch Springer-Presse!): „In Ost-Berlin wusste man natürlich auch, dass man einen Märtyrer erzeugen müsste. In dem Moment war es für die DDR das willkommenste Szenario, dass in der Bundesrepublik bürgerkriegsähnliche Kräfte entstehen, die die Bundesrepublik als faschistischen Staat, als Unrechtsstaat, als kriegstreibenden Staat, als kapitalistisch-imperialistischen Staat und der gleichen mehr brandmarken würde.“
Ja, so denken sicherlich viele. Und man kann argumentieren, dass es alles auch ganz anders ausgegangen wäre. Zum Beispiel, dass kein Fernsehteam in der Nebenstraße des Tatorts drehte. Dass andere politische Probleme in den medialen Vordergrund getreten wären, die sich nicht an den Ohnesorg-Kontext hätten anflnschen lassen. Oder Albertz wäre einfach nicht zurückgetreten.
Nichts desto trotz habe ich Röhls Artikel mit Gewinn gelesen, denn eine Frage stellt sie und die interessiert mich wirklich: War Kurras Doppelagent? Es liegt nahe, denn er war ja nicht nur beim MfS sondern bei der Polizei auch mit der Aufgabe betraut, Spitzel des Ostens zu entlarven. Und in dieser für ihn mit Sicherheit nicht einfach zu überblickenden Konstellation ist das mit dem Doppelagenten nicht ganz abwegig. Aber auch hier die Frage: Hätte das denn etwas Wesentliches geändert?
So, genug gestänkert. Auf eine wilde Rauferei freue ich mich in den Kommentaren.