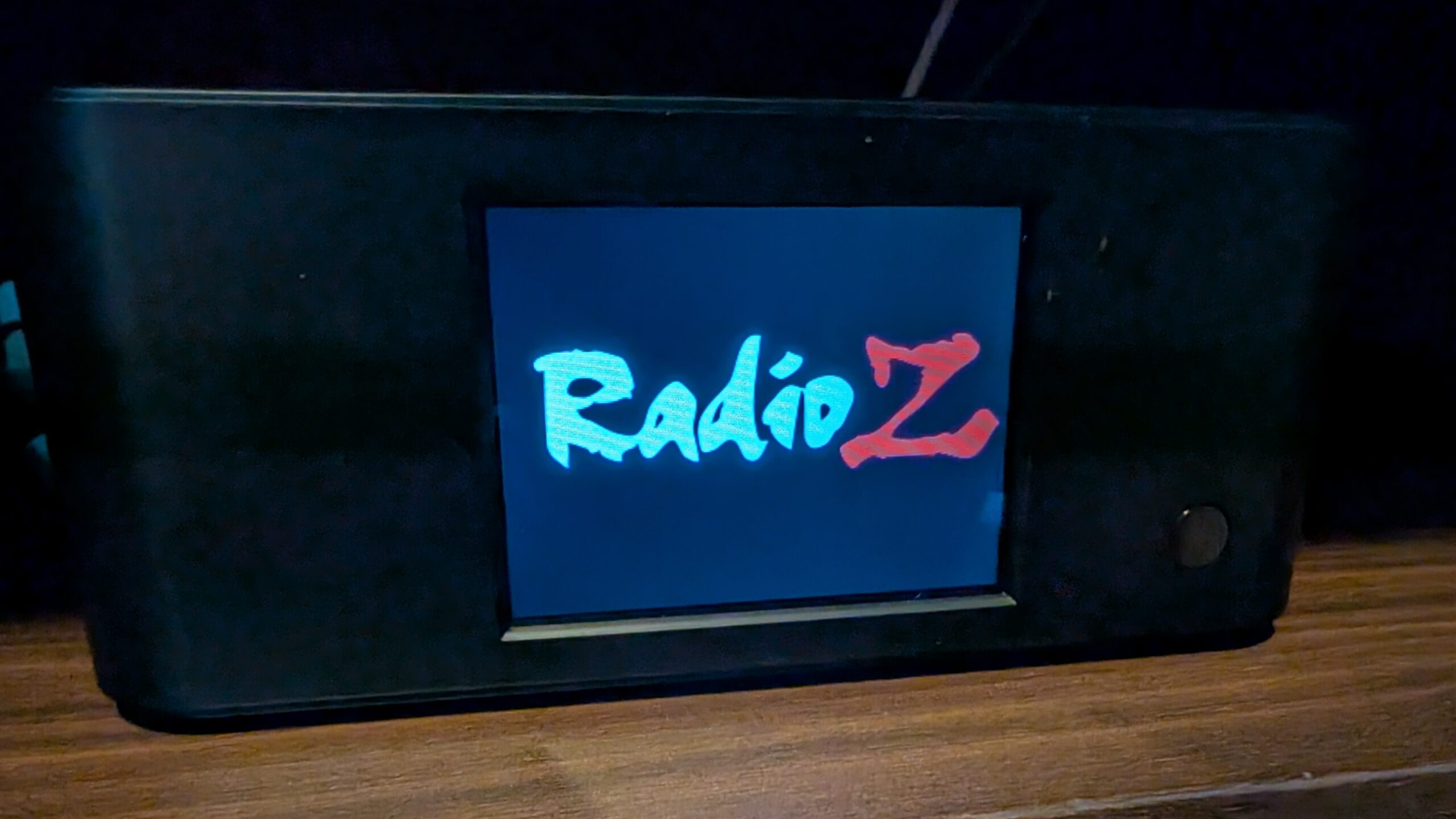Didn’t feel old today? Gut, da kommt Abhilfe: Die MP3 wurde letzten Monat 30! Krass, oder? Dreißig Jahre! Ich erinnere mich noch sehr lebendig an die Zeit, in der ich den ersten CD-Brenner kaufte und die ersten MP3s lud, denn, obwohl ich damals schon Schallplatten sammelte und neben Kassetten auch ein Bandgerät und einen Minidisc-Rekorder besaß, sollte die MP3 die Art und Weise, wie ich Musik hörte, maßgeblich verändern.
Von „der“ MP3 zu sprechen, ist freilich nicht ganz korrekt, handelt es sich dabei doch nicht allein um ein Musikdateiformat, sondern eben um das Kompressionsverfahren, mit dem sich digitale Musik, besonders von CD, erheblich verkleinern lässt. Weil die Endung der Datei .mp3 aber synonym für das heute immer noch de facto Standardformat für digitale Musik nach dem Codec MPEG-1(/2) Audio Layer III ist, behalte ich diese unscharfe Bezeichnung einfachheitshalber bei.
Die MP3 löste damals, also Mitte bis Ende der 1990er Jahre, mehrere zum Teil auch heute noch gegenwärtige Probleme, die des begrenzten Speicherplatzes, der begrenzten Bandbreite und der begrenzten Rechenleistung. Musik wanderte über das Medium CD erst auf den Rechner, dann ins Internet und letztlich auch auf mobile Player.
Die Entwicklungsgeschichte der MP3 wiederzugeben, würde den Rahmen dieses Nostalgie-Posts sicher sprengen. Ein paar Worte seien aber dennoch dazu verloren. Bereits Mitte der 1970er Jahre wurde an der Compact Disc geforscht, zu Beginn der 1980er-Jahre erreichte sie Marktreife. Zur damaligen Zeit existierte weltweit eine sehr rege HiFi-Szene, die an ein neues, digitales Tonträgerformat sehr hohe Ansprüche knüpfte. Die CD konnte diese Ansprüche übererfüllen, man gab dem Privatmann ein günstiges Medium mit professioneller, studionaher und sendefähiger Tonqualität an die Hand, allerdings um den Preis, dass der damalige Kunde keine Aufnahmen auf dem neuen Tonträger anfertigen konnte. Wer bis weit in die Mitte der 90er digitale Tonaufnahmen fertigen wollte, war auf recht teure und nur bedingt oder gar nicht mobile Lösungen angewiesen. Mit einem PCM-Vorsatzgerät konnte man seinen teuren Beta-Videorecorder in ein digitales Tonbandgerät verwandeln, ein Gerät nach dem DAT-Verfahren (qualitativ waren diese Decks selbst für Studiozwecke geeignet) war Ende der 1980er-Jahre nicht unter 3.500 DM zu haben (und scheiterte damit schon am Preis, aber auch an einem künstlich implementierten Kopierschutz, der bei einer Abtastrate von 44,1 kHz bis in die 1990er Jahre nur eine analoge Aufnahme zuließ) und auch das Heimformat DCC, das sehr viel Potenzial hatte, war teuer und kam schlicht zu spät auf den Markt.
Bis auf DCC und später auch MiniDisc hatten die digitalen Audioaufzeichnungs- und Wiedergabegeräte alle ein Problem: Sie erzeugten, weil ohne rechenressourcensparende Kompression gearbeitet wurde, für ihre Zeit enorme Datenmengen. Auf einem physikalischen Medienträger (der in aller Regel nicht billig war) konnte man damit umgehen. Musste dieser Medienträger neben der Toninformation allerdings auch digitale Bilddaten bereithalten, stieß man sehr schnell an Grenzen. Überdies war man kaum in der Lage, einen unkomprimierten digitalen Audiostream zu übertragen.
In den 90ern entwickelte sich zur Lösung dieser Probleme ein Spezialmarkt. Im Hörfunkbereich, gerade bei den Privatsendern, war das „MusicTaxi“ beliebt, ein Hardwarecodierer, der mit gebündelter ISDN-Leitung in Echtzeit ein sendefähiges, komprimiertes Stereosignal in MPEG-1 Layer 2 übertragen konnte. Man benötigte aber zwei untereinander kompatible Codiergeräte und eine bündelbare ISDN-Leitung, die beim Anwählen auch synchron verbinden mussten. Damit war das MusicTaxi nur bedingt für Liveübertragungen tauglich, denn man hatte nicht überall einen entsprechenden Telefonanschluss und die benötigte Hardware zur Verfügung. Ich habe zu Beginn meiner Tätigkeit beim Radio in den 90ern tatsächlich noch mit MusicTaxi gearbeitet und kann mich erinnern, dass man mitunter drei oder vier Anwahlversuche benötigte, bis die beiden „Taxis“ synchron waren. In der Regel benutzte man das „Taxi“, um Beträge und O-Töne von einem Studio zum anderen in einer anderen Stadt zu überspielen, ohne einen Tonträger per Post (langsam) oder Eilboten (teuer) versenden zu müssen. Aufgezeichnet wurden diese Beiträge dann beim Empfängerstudio in aller Regel auf (analogem) Tonband, „Schnürsenkel“, was bedeutet, dass bei der Überspielung sender- wie empfängerseitig mindestens ein Techniker in einem freien Studio zur Verfügung stehen musste. Im öffentlich-rechtlichen Bereich begegnete man dieser Herausforderung über ein sternförmiges Netz von Standleitungen. Das war qualitativ hervorragend, analog wie digital, zudem zuverlässig und höchst ausfallsicher. Wo dies nicht möglich war, nutzte man Richtfunkstrecken. Hierfür wurde ein Netz professioneller Sendeanlagen zu unterhalten. Fürs Fernsehen standen ab den 1980er-Jahren auch Übertragungswagen mit Satelliten-Uplink zur Verfügung. Der Unterhalt, so munkelte man, dieser Infrastruktur, kostete die jeweiligen Sendeanstalten jährlich größere Millionenbeträge.
Die Lösung des Übertragungsproblems (und damit über Bande freilich auch des Speicherproblems) boten Kompressionsverfahren. Geforscht wurde für Pro-Audio und digitale Radio-Übertragungsstandards, an einen Heimmarkt oder gar das Internet dachte Anfang der 1990er Jahre eigentlich niemand. Man war lange Zeit folgender Herausforderung unterworfen: Hohe Kompressionen mit akzeptablem Klang erforderten sowohl beim Codieren als auch bedingt beim Decodieren eine hohe Rechenleistung, die hatte man nicht. Niedrige Kompressionsraten machten eine hohe Bandbreite und im Nachgang auch große Speicherkapazitäten notwendig, die hatte man auch nicht. Es war also alles recht kompromissbehaftet.
Auch die Idee, am Erlanger Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen zu Adiokompression zu forschen, hängt, wie dieser heise-Artikel darlegt, eng mit dem Wunsch zusammen, Tonmaterial in HiFi-Qualität über das Telefonnetz zu übertragen. Mit neuen Prozessoren ließen sich Anfang der 1990er Jahre erstmals MP3-Bitstreams in Echtzeit codieren und wurden zur Radioübertragung, ähnlich dem MusicTaxi verwendet. Professor Brandenburg, so berichtet heise, setzte auf externes Anraten auf PCs und das Internet und sollte damit Erfolg haben – MP3 kam wie gerufen. Mitte der 1990er-Jahre hatten viele Büro- und Heim-PCs noch Festplatten mit wenigen 100 MB Speicherkapazität. Den unkomprimierten Inhalt einer Audio-CD hätte man auf so einer Festplatte neben dem Betriebssystem nicht unterbringen können. Einige MP3-Files abzuspeichern, war aber kein Thema. Doch mit dem Einzug des Internets hatte der Siegeszug des Kompressionsverfahrens MP3 noch nicht begonnen. Dazu bedurfe es erst des „Hacks“ eines Australiers, der mit gestohlenen Kreditkartendaten den etwa 250 US-Dollar kostenden Codec „erwarb“ und ein kleines grafisches Tool zur Verwendung dazuschrieb und dieses funktionale Bundle als „Freeware“ ins Netz stellte. Die Early Adopters verstanden sofort, dass diese „Freeware“ in der Lage war, das bisher ungelöste Problem, Musikdateien in vernünftiger Qualität über die sehr schmalbandigen Modemverbindungen jener Tage zu übertragen, zu lösen. Es dauerte nicht lange, bis im Rahmen des LAME-Projekts aus einem Patch der Fraunhofer-Software ein eigener, performanter open source-Encoder wurde: Der Siegeszug der MP3 war nicht mehr aufzuhalten. Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als man in Aufnahmesoftware noch manuell den LAME-Encoder einbinden musste, um mit MP3s arbeiten zu können.
Und dann sind wir auch schon im Jahr 1998 und 1999 angekommen – der Siegeszug der MP3 sollte durch das aufkommende Internet, die Dateitauschbörsen, aber auch die Möglichkeit, erstmals halbwegs kostengünstig CDs brennen zu können, befeuert werden. Das mit dem CD-Brennen mag aus heutiger Sicht etwas befremdlich klingen, allerdings waren gebrannte CDs für wenigstens zehn Jahre das Medium, um Musik im Freundes- und Familienkreis aufnehmen und tauschen zu können. Mein erster CD-Brenner, ein Gerät von Philips, hatte die Möglichkeit, CDs in sagenhafter doppelter Geschwindigkeit zu brennen (x2), er kostete einen für damalige Zeit (1998) auch spottbilligen Betrag von 850,- Mark. Ein CD-Rohling mit seinen 650 MB Speicherkapazität war selten unter 7,- Mark zu bekommen, das machte aber nichts, brachte man auf so einem Medium doch locker sechs bis acht Musikalben in MP3 unter. Musik hörten wir vor dem Rechner oder warfen lange Audiokabel vom Schreibtisch zur Stereoanlage. Wir hatten bald gelernt, wie man eigene CDs in MP3s konvertiert. Diese Dateiensammlungen ließen sich schnell und unkompliziert tauschen. Um die Jahrtausendwende explodierte der Festplattenspeicherplatz. Musste der Rechner von 1998 noch mit 6 GB Plattenplatz zurechtkommen, hatte mein Desktop-PC aus dem Jahr 2001 oder 2002, so genau weiß ich das gerade gar nicht mehr, bereits eine 80 GB-Platte verbaut. Und mit diesen Speichermöglichkeiten wuchsen auch die MP3-Sammlungen. Dienste wie Audiogalaxy und Napster taten ihr Übriges, auch wenn wir uns damals noch – im wortwörtlichen Sinne – mit langsamen Modems und getakteten Verbindungen über die Telefonleitung ins Internet einwählten. Die ersten billigen DVD-Player konnten MP3-CDs ohne Schwierigkeiten wiedergeben. Vielleicht genügte die Tonqualität dieser Geräte nicht, um die Bedürfnisse Audiophiler zu befriedigen, für den normalen Nutzer revolutionierte die MP3 die Art, digitale Musik zu hören.
Nur mobil ließ sich die MP3 noch nicht wirklich hören. In den ausgehenden 1990er Jahren gab es freilich erste MP3-Player, diese waren aber nicht günstig und verfügten über nur wenig Speicherplatz. Man verwendete sog. „Smart Media“-Karten, die nur wenige Megabyte Kapazität boten. Ein Mitschüler hatte tatsächlich einen Rio PMP300, ein Gerät, um das ich ihn sehr beneidete. Mit einem klassischen Kassetten-Walkman war man in jenen Tagen aber technisch nicht wirklich schlechter gestellt, denn der Rio hatte 32 MB (!) internen Speicher und war mit einer SM-Karte um weitere 64 MB erweiterbar. Damit konnte man in akzeptabler Qualität etwa genauso viel Musik speichern, wie auf eine C90-Kassette passte. Der Vorgang, eine Leerkassette mit Musik zu bespielen, dürfte wohl ähnlich lang gedauert haben wie diese ersten MP3-Player über die Parallelschnittstelle mit Musik zu befüllen. Davon, dass man diese Geräte nicht einfach im nächstbesten Elektromarkt kaufen konnte, und man, hatte man eines erstanden, sich erst einmal mit der Installation diverser Treiber und anderer proprietärer Software auseinandersetzen musste, gar nicht zu sprechen. Bevor sich der MP3-Player in der Masse durchsetzen konnte, gab es besondere tragbare CD-Player im Stile des „Discman“, die auch MP3s abspielten. Sie kosteten zwischen 200,- und 300,- Mark und lösten das Speicherkartenproblem, das die ersten MP3-Player hatten. Ich hatte auch so ein Gerät – von der Klingelton- und Handyspielemarke Jamba der Samwer-Brüder. Die hatten eben nicht nur „Paid Content“, sondern vertrieben über einen kurzen Zeitraum auch Hardware, um MP3s wiederzugeben. Das Ding hielt ein, zwei Jahre.

2003 kam dann der erste richtige MP3-Player, ein Mpaxx SP 4010 des Herstellers Grundig, wenn ich mich nicht irre. Hier im Fränkischen war Grundig zu dieser Zeit noch eine gesetzte Marke, der Player mit rund 100,- Euro recht günstig, zudem bot das zigarettenschachtelgroße Gerät mit angenehmem Alugehäuse zwei Slots für SD bzw. MMC-Karten. Und weil solche Karten seinerzeit vor allem dann, wenn sie eine höhere Kapazität hatten, relativ teuer waren, kam diese seltene Zweischacht-Lösung sehr gelegen. Ich kaufte zwei günstige MMC-Karten (die waren weiland einfach mal ein Viertel billiger, als SD-Karten) und hatte dann, zusammen mit dem Gerätespeicher, einen tollen kleinen Player.
 Doch schon bald erreichte mich der iPod der 3. Generation und schickte den Grundig, bei dem man um jedes Megabyte Speicherplatz feilschen musste, in Rente. Okay, er war sauteuer und hielt nicht wirklich länger als anderthalb Jahre, zudem ließ er sich, ganz Apple-like nur per Firewire-Anschluss und der proprietären iTunes-Software mit Musik bestücken, doch das alles nahm man hin. Ein logisches Menü, sagenhafte 40 GB Speicher und Touch-Bedienung bei einer langen Laufzeit des internen Akkus sorgten dafür, dass ich dieses Gerät mehrere Stunden täglich nutzte. Der iPod war eine echte Revolution, denn er wischte alle Nachteile, die andere Hardware immer mit sich brachte, mit einem Handstreich vom Tisch.
Doch schon bald erreichte mich der iPod der 3. Generation und schickte den Grundig, bei dem man um jedes Megabyte Speicherplatz feilschen musste, in Rente. Okay, er war sauteuer und hielt nicht wirklich länger als anderthalb Jahre, zudem ließ er sich, ganz Apple-like nur per Firewire-Anschluss und der proprietären iTunes-Software mit Musik bestücken, doch das alles nahm man hin. Ein logisches Menü, sagenhafte 40 GB Speicher und Touch-Bedienung bei einer langen Laufzeit des internen Akkus sorgten dafür, dass ich dieses Gerät mehrere Stunden täglich nutzte. Der iPod war eine echte Revolution, denn er wischte alle Nachteile, die andere Hardware immer mit sich brachte, mit einem Handstreich vom Tisch.
Nach dem iPod kam noch ein iPod Video, dessen Videofunktion ich aber angesichts des selbst für damalige Verhältnisse schon übersichtlich dimensionierten Displays nie ernsthaft nutzte, dann waren, das mag auch der Einführung des iPhones und kurz danach auch der technisch gleichwertigen Android-Telefone geschuldet sein, iPods schnell überholt. Der Vorzug der iPods, mit einem großen internen Speicher ausgestattet zu sein, geriet freilich mit den kontinuierlich steigenden Speicherkapazitäten und dem Preisverfall der micro-SD-Karten in den Zehnerjahren ins Hintertreffen, und so kamen, neben der Musiknutzung auf dem Smartphone, neue MP3-, später auch HiRes-Audioplayer in die Hände der geneigten Kundschaft. Damit, und auch mit dem aufkommenden Musikstreaming, geriet die MP3 als Dateiformat ein wenig aus dem Zentrum der Betrachtung, andere, teils noch effektivere Kompressionsverfahren oder Lossless-Formate wurden nun alltagstauglich.
Die MP3 selbst allerdings war nie weg und ist nach all den Jahren immer noch der Quasi-Standard für komprimierte Musikdateien, sei es im Bereich der Podcasts, der Audiotheken, der Downloads, sei es im Bereich digitaler Diktier- und Aufzeichnungsgeräte und auch im Bereich des Home Entertainments – und das, obwohl es mittlerweile technisch bessere und effektivere Kompressionsverfahren gibt. Warum nur?
Ich denke, dass das daran liegt, dass jedes noch so einfache Audiogerät heute in der Lage ist, MP3-Dateien wiederzugeben. Damit sind sie im Hinblick auf die Kompatibilität dieses Dateiformats schlicht der kleinste gemeinsame Nenner (und wohlgemerkt ein in der Regel recht gut klingender und mit wenig Kompromissen behafteter gemeinsamer Nenner). Egal, ob man eine Audiodatei mit einer unbekannten Medienplayersoftware, per USB mit einem Fernseher oder per Speicherkarte mit einem Smart Speaker, Digitalradio, Auto-Unterhaltungssystem, einem Handy… wiedergeben will, die MP3 läuft eigentlich immer. Das ist ihre Stärke. Mittlerweile ist auch die Lizenzierungspflicht für die Hardwarehersteller ausgelaufen, so werden Wiedergabegeräte, wenn sie das denn sein sollen, auch noch beliebig billig.
Wie gut oder schlecht klingt eine MP3, die ja gemeinhin als veraltet gilt, heute noch? So gut wie immer – würde ich behaupten. In den letzten Jahren, zuletzt erst vor zwei Monaten, habe ich an Hörsessions teilgenommen, die MP3 und andere Formate auf guten Set-ups zu Gehör brachten. Eine ordentliche Codierung und eine Bitrate von wenigstens 320k, wie wir sie schon in den 2000ern benutzten, vorausgesetzt, sind die klanglichen Unterschiede zur CD und selbst zu höher auflösendem Audiomaterial marginal und bestenfalls in minimalen Asynchronitäten im Tiefbassbereich und quasi vernachlässigbarer Artefaktbildung bei manch hochtonigen Passagen erahnbar.
Ich bin mir vollends bewusst, dass so mancher High-End-Spezl mich jetzt als Holzohr titulieren wird, aber: Wer das vierte oder gar fünfte Lebensjahrzehnt überschritten hat, dürfte schon allein wegen des nachlassenden Gehörs im Alter kaum mehr in der Lage sein, wesentliche Unterschiede zu registrieren. Um diese wirklich sicher ausmachen zu können, bedarf es eines auf das Erkennen dieser Unterschiede geschulten Gehörs, das oft, wie ich erfahren durfte, selbst Musiker nicht haben. Ist die MP3-Datei also ordentlich codiert, wird der normale Musikhörer keine größeren Defizite hören und zufrieden sein, selbst unter Verwendung von Equipment, das mehrere tausend Euro kostet.
Wer Abweichungen durch die Codierung wirklich hören will und auch bei einem Blindtest bestehen möchte, muss wirklich gründlich darauf trainiert sein, technische Unzulänglichkeiten identifizieren zu können.
Um die Jahrtausendwende habe ich mir in einer Tonregie mal den Unterschied zwischen MP3 und einer CD vorführen lassen, aus der Erinnerung heraus war er nicht hörbar, und das, obwohl allein die Geithain-Monitore dieses Regieraums um die 20.000 Mark gekostet haben dürften und der Raum bereits beim Bau des Studiokomplexes auf das Abhören von Audiomaterial optimiert war. Heute ist gute Elektronik – Stichwort „HD Audio“ – relativ günstig geworden, auch vernünftige Lautsprecher verfügen gegenwärtig über Leistungsparameter, die vor dreißig Jahren in annehmbaren Preisregionen kaum denkbar gewesen wären. Und selbst mit sehr analytischen und „hochauflösenden“ Kopfhörern sind echte Unterschiede mehrheitlich nur sehr schwer feststellbar. Das Detail, dass Brandenburg auf den alten Fotos im heise-Artikel, Elektrostatenkopfhörer der Edelmarke Stax trägt, finde ich ganz witzig, denn die damals (wie übrigens auch noch in hoher Zahl heute) gängigen und tausendfach in Studios verwendeten Monitorkopfhörer von AKG, Beyer oder Sennheiser waren sicherlich nicht in der Lage, Unterschiede hörbar zu machen.
Freilich gibt es auch viele miese MP3s, schlecht codiert, fehlerhaft gepegelt, mit geringer Samplingrate und niedrigen Bitraten, Joint Stereo, aus unzureichenden Webstreams mitgeschnitten, von verkratzten selbst gebrannten CDs gerippt oder von längst verschwundenen defizitären Ausgangsformaten wie RealMedia laienhaft umgewandelt… Gerade in den späten 90ern und frühen 2000ern waren solche Dateien ein Ärgernis. Sie waren, es stand ja wenig Bandbreite zur Verfügung, leider recht verbreitet und begründeten nach meinem Dafürhalten den schlechten Ruf von MP3. Wandelt man aber die Titel einer CD sorgsam in gute MP3-Dateien, so muss man schon genau wissen, worauf man zu achten hat, um überhaupt einen Unterschied hören oder sogar messen zu können. Oft gelingt das auch gar nicht.
So komme ich zu der Überzeugung, dass uns die MP3 auch noch in den nächsten Jahrzehnten begleiten wird, als Manko betrachte ich das nicht. Es werden neue Audioformate kommen. Und gehen. Die MP3 hat sich aber als Standard in einer Welt etabliert, in der neue Standards allein um Willen der Profitmaximierung und der Festigung der eigenen Marktmacht in eben jenen Markt gedrückt werden. Das wird immer wieder versucht, klappt aber (wenig überraschend) nur sehr selten. Die für einen Gutteil der Zwecke absolut hinreichende Qualität der MP3, die hohe Kompatibilität und Akzeptanz werden dem Format, freilich neben anderen auch, noch auf Jahrzehnte die Existenz sichern. Es hätte schlechter kommen können.