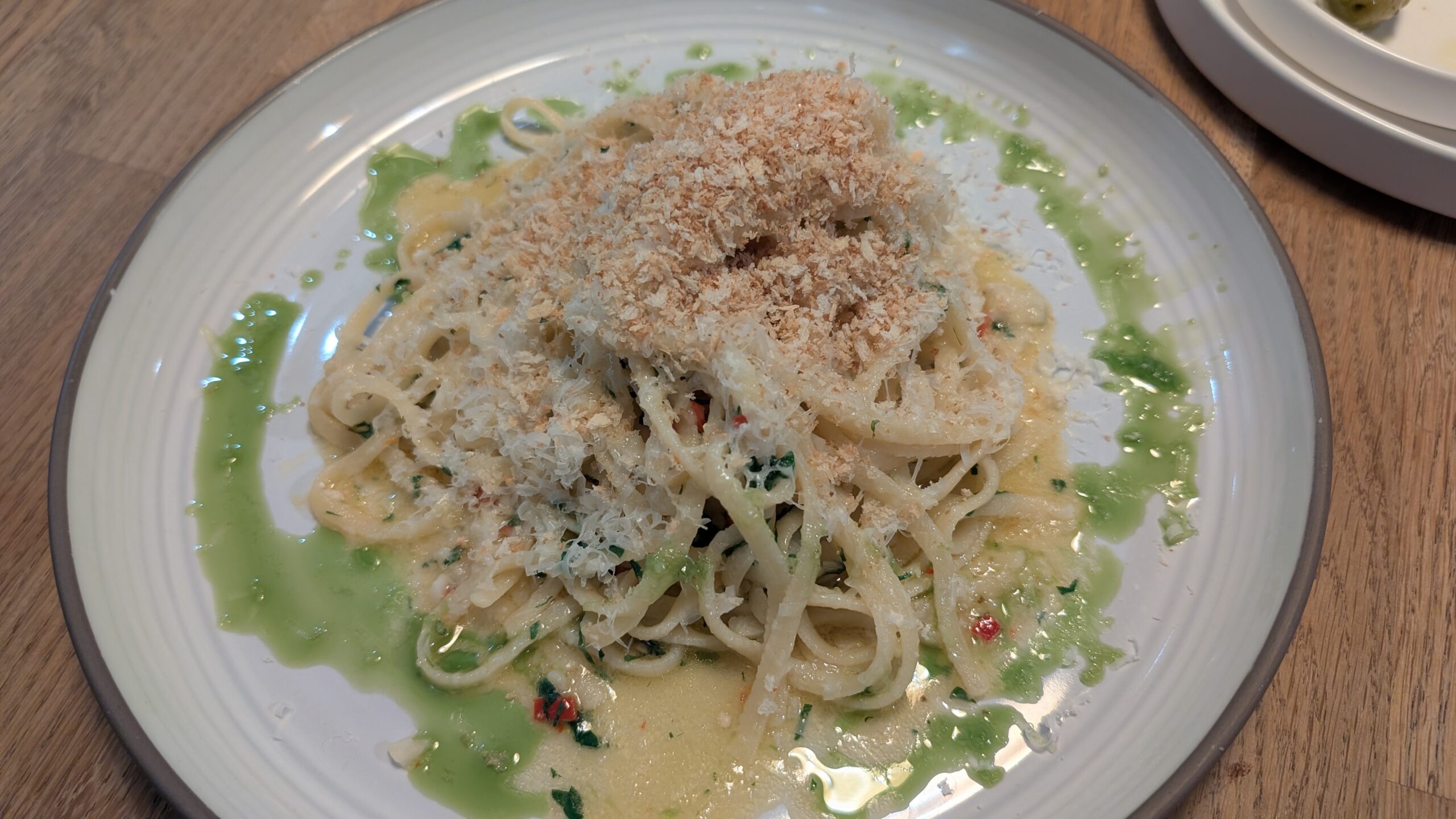Diesen Post, darum möchte ich bitten, möget Ihr, liebe Leserinnen und Leser, nicht allzu ernst nehmen, behandelt er doch ein Thema, das eine allzu große Gravitas kaum verdient. Auf der anderen Seite – cum grano salis – birgt es doch das Potenzial, die Nürnberger Volksseele zum Kochen zu bringen. Alle Auswärtigen (darunter zähle ich auch die Fürther) möchten zudem bitte auch über meinen Lokalpatriotismus in Milde und Güte hinwegsehen.
Es geht um den Nürnberger Lebkuchen. Und ein so edles Gebäck von Rang und Stand, von so nobler Herkunft, verträgt keinen Spaß.
Der Nürnberger Elisen-Lebkuchen ist in der Tat etwas ganz Besonderes. Hergestellt werden darf er nur im Stadtgebiet unter teils strenger Überwachung, seine Bestandteile und vor allem Nicht-Bestandteile sind im Deutschen Lebensmittelbuch genauestens geregelt, zwei unabhängig voneinander arbeitende Schutzverbände wachen akribisch über die Einhaltung der traditionellen Regularien. Bei so viel Reglement möchte man auf die Idee kommen, der Nürnberger Elisen-Lebkuchen sei ein weitgehend generisches Produkt – doch weit gefehlt! In den Feinheiten von Konsistenz, Rezeptur und Würzung, Backdauer und Backtemperatur trennt sich die Spreu vom Weizen (letzterer darf gemahlen nur zu zehn Prozent im Gebäck enthalten sein, ein qualitätvoller Lebkuchen enthält aber grundsätzlich gar kein Getreidemehl).
Wie viele Lebküchner es in Nürnberg gibt, war mit einer mittellangen Recherche nicht zweifelsfrei auszumachen. Neben einer Handvoll industrieller Großbetriebe produzieren in Nürnberg etliche mittelständische Lebküchnereien und vor allem viele bestbeleumundete Handwerksbetriebe diese köstliche Königin des Backwerks. Man muss in Nürnberg, auch wenn der Franke das gemeinhin gerne tut, sein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Nicht allein geschmacklich, sondern auch den Einsatz hochwertiger Rohmaterialien betreffend, ist der feine Nürnberger Elisen-Lebkuchen unbestritten das beste Weihnachtsgebäck – weltweit, wohlgemerkt. Und daher genießt er, auch das ist keine Übertreibung, mit Fug und Recht Weltruhm.
Angesichts der vielen Produktionsbetriebe in Nürnberg und angesichts der vielen Superlative, die der feine Elisen-Lebkuchen kaiserstädtischer Herkunft in sich zu vereinen weiß, ist die Frage nach dem Besten unter den Besten selbstredend eine ernste Angelegenheit.
Und ein veritabler Streitpunkt in Nürnberger Familien. Denn die bevorraten sich, sofern sie ähnlich lokalpatriotisch aufgestellt sind, wie der Autor dieser Zeilen, zur Weihnachtszeit mit etlichen Kilogramm Elisen aus der von ihnen nach langem Probieren und Abwägen zum Hoflieferanten auserkorenen Lebküchnerei. Zehn, dreißig, fünfzig Elisen-Lebkuchen darf man in Nürnberg noch unbescholten in die Kategorie „Eigenbedarf“ einordnen.
Kommen wir zurück zur ernsten Frage: Wer backt den besten Nürnberger Lebkuchen? Diese hochumstrittene Frage stellt sich jedes Jahr zur Weihnachtszeit. Es ist, das ist einfach zu sagen, sehr schwierig zu sagen. Selbst der renommierte Falstaff drückt sich um die Antwort und präsentiert lediglich eine Auswahl, auch die offizielle Webseite der Stadt Nürnberg möchte sich nicht festlegen. Das inzwischen leider nicht mehr aktualisierte „Nürnberg und so“-Blog war weiland etwas mutiger und kürte 2014 letztmalig die besten Lebkuchen, damals hatte Rainer Nusselt die Nase vorn, äußerst knapp gefolgt von Holger Düll und den Lebkuchen der Konditorei Witte. Im Vorjahr waren die Lebkuchen der Familie Düll Spitzenreiter. Doch seit über zehn Jahren hat sich an das heikle Thema niemand mehr herangewagt – bis zum heutigen Tage. Denn nun hat unsere Lokalzeitung den in einer Umfrage ermittelten Sieger bekannt gegeben. Wer das ist – dazu später mehr.
Im hiesigen Pressehaus hat man reichlich Erfahrung mit Votings um Bestenplätze. Der Verlag Nürnberger Presse suchte schon den besten Döner der Stadt, die beste Pizza der Stadt und das beste fränkische Bier (der Region). Die Abstimmung steht nicht nur den Abonnenten der beiden Zeitungstitel des Hauses offen, im Prinzip kann jeder, der möchte, daran teilnehmen. Das erhöht freilich die Größe der Stichprobe. Ob man damit allerdings ein möglichst unbeeinflusstes Ergebnis ermitteln kann, dahinter darf man getrost ein vorsichtiges Fragezeichen setzen. Als geneigter Leser konnte ich mich in der Vergangenheit schon mehrmals nicht des Eindrucks erwehren, dass das Voting nicht von tatsächlich im Volke sorgsam abgewogenen Qualitätseindrücken dominiert war, sondern von dem gewonnen wurde, dem es per Online- und Social-Media-Marketing am besten verstand, seine Fans zur Stimmabgabe zu bewegen.
Ob dieser Eindruck sich wirklich bestätigt und ob das beim Lebkuchen-Voting auch eine Rolle gespielt hat, das kann ich mit letzter Sicherheit nicht sagen. Vielleicht war es auch ganz anders.
Der Lebkuchen ist ein Traditionsprodukt. Freilich gehen viele Lebkuchen in den Versand, die Firma Lebkuchen Schmidt, ein großer Industriebetrieb, macht einen Gutteil ihres Umsatzes über das Versandgeschäft. Der Nürnberger selbst allerdings kauft seine nicht-industriell gefertigten Lebkuchen vor Ort. Wer hier, an Theke und Kasse, durch ein geschicktes Verkaufsgespräch seine Kunden zur Abstimmungsteilnahme motiviert bekommt, der hat wenigstens die halbe Miete eingespielt.

Witte Spezialitäten, Fürth
Dieser Tage fand ich mich, es ist der Jahreszeit und meiner Naschlust geschuldet, an drei Lebkuchen-Verkaufstheken wieder: der der Lebkucherei Düll in der Mathildenstraße, der der Lebküchnerei Pia und Bernhard Woitinek in der Peter-Henlein-Straße und auf dringende Empfehlung eines Freundes auch an der der Konditorei Witte in der Gründlacher Straße (in Fürth! Gut, dass ich Protestant bin, andernfalls hätte ich das jetzt beichten müssen).
Mein Besuch in den Häusern Düll und Witte lief so, wie man sich den Besuch in einer Bäckerei oder in einem Lebensmittelgeschäft gemeinhin vorstellt. Nach Betreten des Ladenlokals äußerte ich meine Wünsche, bekam Lebkuchen ausgehändigt, bezahlte und ging. Bei der Lebküchnerei Woitnek in der Peter-Henlein-Straße lief es im Prinzip genauso, zwischen der sehr freundlichen Verkäuferin und uns entspann sich aber ein interessanter Dialog, den ich hier nicht vollständig wiedergeben kann, der aber mehrere spannende Informationen enthielt. Beim Bezahlen wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass gerade ein großes Voting der NN liefe und man sich sehr freue, wenn man für die Woitinek-Lebkuchen stimme. Ein entsprechender Hinweiszettel mit QR-Code auch zur Google-Bewertung, war am Verkaufstresen angebracht.

Verkaufsraum der Lebküchnerei Woitinek in der Peter-Henlein-Straße
Ich erfuhr zudem, dass es zwei Woitineks in Nürnberg gibt (den Lebküchner und den Bäcker), durfte den Laden für den Artikel fotografieren und bekam zudem die Information, dass man bei Woitinek auch glutenfreie Lebkuchen aus eigener Herstellung anbietet.
Nun ist es leicht vorstellbar: Wer einen gut laufenden Laden mit hoher Kundenfrequenz betreibt, dort auf das Voting gut sichtbar hinweist und zudem proaktiv seine Kunden bittet, an der Abstimmung teilzunehmen, der wird sich auf diesem direkten Wege möglicherweise sogar entscheidende Stimmanteile sichern können. Dagegen ist auch nichts einzuwenden. Wer das Voting als Baustein seines eigenen Marketings erkennt und sich entsprechend engagiert, darf auch den Erfolg ernten. Spannend allerdings ist, dass man es mit den Lebkuchen in Nürnberg scheinbar bierernst meint. So gibt das Pressehaus in dem oben verlinkten Artikel bekannt:
Leider mussten wir feststellen, dass unsere Umfrage technisch manipuliert worden ist. Die Bot-Attacken hatten in den vergangenen Tagen massiv zugenommen, sprich: Computerprogramme gaben automatisiert und im großen Stil Stimmen ab. Am Ende mussten wir über 1000 ungültige entfernen. Fair Play geht anders.
Da kann ich nur staunen. Ein Lebkuchen-Voting ist ja im Grunde ein Gag und genauso wenig ernst zu nehmen wie ein Bier-Voting oder ein Pizza-Voting. Welches Produkt jetzt das beste ist, lässt sich damit kaum ermitteln. Denn so wie es gut und gerne dreißig unabhängige Bäckereien mit eigenen Lebkuchen und Lebküchnereien in Nürnberg gibt, gibt es in der Noris hunderte Pizzerien, in Franken aberhunderte Brauereien. Kein Bürger wird den Direktvergleich von dreißig Elisen-Lebkuchen, hunderten Pizzen oder sechs-, siebenhundert Bieren haben (auch wenn das zweifelsohne schön wäre). Es ist wie in der Politik: Der Bürger wählt, was er namentlich kennt, mit etwas Glück sogar das, was er zu mögen meint. Dass man bei so einem, freilich bedingt auch marketingtauglichen, Spaß ernsthaft den Aufwand einer technischen Manipulation betreibt, ist mindestens irritierend. Da nimmt also jemand das Ding mit den Lebkuchen tatsächlich bierernst.

„Kleines Elisen-Seidla“ Schanzenbräu x Wicklein Nürnberg
Das mit dem Bierernst, das möchte ich am Rande, „off topic“ anmerken, kann man in diesen Wochen ganz praktisch probieren. Die Brauerei Schanzenbräu hat in Zusammenarbeit mit Wicklein ein „Elisen-Seidla“, ein Biermischgetränk aus Hellem und Lebkuchen-Gewürztee, herausgebracht, das zumindest interessant schmeckt. 0,33 Liter kosten recht stolze 4,- Euro.
Zurück zum Voting. Das hat die Lebküchnerei Woitinek in der Peter-Henlein-Straße, deren Produkte nicht mit den Lebkuchen des Bäckers und Bruders Wolfgang Woitinek in der Saarbrückener Straße (Luftlinie etwas mehr als vier Kilometer) verwechselt werden dürfen, mit einem Vorsprung von 250 Stimmen vor Rainer Nusselt gewonnen. Witte, Düll und Der Beck (?!) machen den dritten, vierten und fünften Platz. Woitinek gönnt man den ersten Platz. Der Bäckermeister ist bemüht, trotz massiv gestiegener Haselnuss- und Kakaopreise den handwerklich gemachten Lebkuchen nicht zu einem Luxusartikel werden zu lassen, der Fünferpack kostet auch in diesem Jahr noch immer unter zehn Euro.
Im Prinzip ist es aber völlig egal, wer das Voting gewonnen hat, denn man kann schlicht und ergreifend nicht den besten Lebkuchen bestimmen. Und den besten Lebküchner auch nicht. Deren Produkte sind, analog zu den Geschmäckern der Kundschaft, völlig unterschiedlich. Manche Lebküchner backen ihre Lebkuchen sehr fein, bei anderen ist der Teig durch die Nüsse eher grob, einige backen den Lebkuchen auch ganz bewusst stückig-spundig. Mindestens genauso wichtig sind die verwendeten Gewürze. Der eine bevorzugt eine dominante Zimtnote, ein anderer Lebkuchen ganz ohne Zimt. Mancher Lebkuchen hat eine sehr vordergründige, weihnachtlich-warme Würzung, ein anderer wiederum ist nur sehr zurückhaltend gewürzt und lässt den Nuss- und Mandelaromen den Vortritt, der nächste wiederum schmeckt vordergründig vor allem mazipanig-weich. Welcher soll nun der beste sein?
Mit dem Voting hat das Pressehaus aber allen Lebküchnern der Stadt einen Dienst erwiesen – zeigt es doch die unglaubliche Vielfalt des Lebkuchens, seine tiefe Verwurzelung in seiner Heimatstadt und seine kompromisslose Güte. Was wäre die Vorweihnachtszeit ohne Lebkuchen? Eben.
Nun bleibt eigentlich nur eine Frage offen: Welcher ist der Lieblingslebkuchen des Autors dieser Zeilen? Ich drücke mich um eine Antwort, auch, weil wir immer mal wieder Neues ausprobieren. Soviel sei aber gesagt: Die kräftig-spundigen Lebkuchen der Bäckerei Düll sind bei uns ganz weit vorn. Sehr gerne essen wir auch die wesentlich teigfeineren und zurückhaltender gewürzten Mirus-Lebkuchen. Auch die Lebkuchen von Woitinek aus der Peter-Henlein-Straße schmecken hervorragend. Angenehm weich, kräftig gewürzt und dennoch nicht zu süß. Und in diesem Jahr haben wir auch die Lebkuchen von Bäcker Wolfgang Woitinek für uns entdeckt, sie sind geschmacklich sehr fein abgestimmt und ebenfalls wunderbar zart. Erstmalig haben wir in diesem Jahr auch Witte gekostet – es gibt immer was zu entdecken!