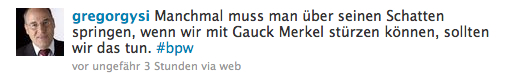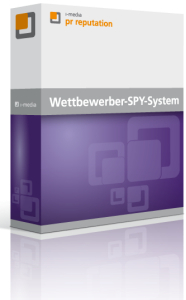Es ist Donnerstag, der 29. April. Ich gehe morgens ins Büro und fahre meinen Rechner hoch. Schon bald, nachdem der Spam weggeklickt ist, entdecke ich eine Mail von einem Stammleser dieses Blogs, nennen wir ihn Thomas Müller. Thomas bittet mich um Hilfe. Er hat einen Brief von der Firma Sirius Inkasso GmbH zu Düsseldorf erhalten und weiß nicht so recht, was er damit anfangen soll.
Ich greife zum Telefonhörer. Thomas erklärt mir, was vorgefallen ist. Thomas ist 34, er kommt ursprünglich aus dem oberfränkischen Bamberg. Dort steht sein Elternhaus. Seit dem Jahr 2000 wohnt Thomas in Nürnberg. Dort versah er seinen Zivildienst und dann ist er in Nürnberg geblieben – der Liebe wegen und auch wegen dem Job im Innendienst, den er gleich nach dem „Zivi“ in der Frankenmetropole bekam. Thomas kaufte damals gebraucht ein Auto, es war zwar nur ein alter Audi 80 – aber es fuhr. Er zog in seine erste eigene Wohnung. Ein guter Start in ein Leben abseits des Elternhauses. Was will da schon passieren.
Thomas brauchte eine KFZ-Versicherung und wollte auch eine „Haftpflicht“. Er ging einfach zum nächsten Büro der Volksfürsoge und unterschrieb ein paar Papiere. Die Haftpflichtversicherung hatte er nun in der Tasche und der alte Audi war auch versichert. „Von der Volksfürsorge“, so sagt Thomas, „dachte ich immer, dass die zu den Gewerkschaften gehören. Da fühlte ich mich gut aufgehoben“. Dass die Volksfürsorge bereits ab 1988 zur Aachener und Münchener gehörte, war Thomas nicht bewusst. Das soll aber auch keine Rolle spielen.
Thomas bekommt am 20. April 2010 Post von der Sirius Inkasso GmbH – doch so ganz stimmt das nicht. Denn der Brief erreicht Thomas nicht in seiner Wohnung in Nürnberg sondern liegt im Briefkasten seiner Mutter in seinem Bamberger Elternhaus. Die sieht das Schreiben, erkennt, dass es wichtig sein könnte und schickt den Brief noch am gleichen Tag nach Nürnberg.
Und nun liegt er, gescannt, in meinem Mailpostfach. Thomas erzählt mir am Telefon, dass er sich gar nicht vorstellen kann, woher denn diese Forderung kommt, zwar hatte er eine Versicherungen bei der Volksfürsorge, aber die ist seit Jahren gekündigt.

ein Klick auf das Bild vergrößert es
Das Schreiben kommt mir suspekt vor: Zwar wird genannt, dass es sich um eine Forderung der Generali Versicherung handelt und dass es sich wohl um einen Vollstreckungsbescheid eines Amtsgerichtes handeln soll, welches Amtsgericht das sei, worum es genau geht oder unter welchem Aktenzeichen ein Gericht besagten Bescheid führt, legt das Scheiben aber nicht dar.
Ich greife wieder zum Telefonhörer und wähle die Nummer der Pressestelle der Generali Holding in Köln. Ein sehr netter Herr, dessen Namen ich hier nicht nenne, weil er, so wurde mir inzwischen telefonisch bestätigt, nicht mehr in Diensten des Hauses Generali steht, bittet mich, Ihm den Fall noch einmal kurz per Mail darzulegen. Fix hat er ein Mail von mir, in dem ich ihn wiederum dringlich bitte, zur Klärung beizutragen. Ich will wissen, woher die Forderungen der Sirius Inkasso, die diese ja im Namen der Generali geltend macht, eigentlich stammen.
Ich halte lose den Kontakt zur Pressestelle der Generali und erfahre, dass meine Anfrage inzwischen von der Leiterin Externe Kommunikation, Frau Haake weiterbearbeitet wird. Am Montag, den 3. Mai, nach einigen Telefonaten ruft mich Frau Haake auf dem Handy zurück. Sie sagt mir, dass sie den Kontakt zu ihren Kollegen nach München hergestellt habe und das man ihr dort mitgeteilt hätte, dass die Generali nicht feststellen könne, dass Thomas Müller Außenstände bei der Versicherung habe. Ich freue mich für ihn, werde aber auch stutzig. Wenn die Generali kein Geld von Thomas bekommt, wie kommt dann die Sirius Inkasso dazu, Geld von ihm eintreiben zu wollen? Die Aussage von Frau Haake und der Brief der Sirius Inkasso GmbH wollen nicht so recht zusammenpassen.
Thomas war in der Zeit nicht untätig. Er rief sofort nach Erhalt des Briefes der Sirius bei der Generali in München an und klapperte Hotline um Hotline ab. Bei der Volksfürsorge fragte er nach, ebenso bei seinem aktuellen Versicherer, der Aachen Münchener, die auch zum Generali-Konzern gehört. Am Telefon sagte man ihm immer das gleiche: Offene Forderungen könne man nicht feststellen.
Dieses Ergebnis diskutiere ich mit der engagierten Pressesprecherin und schnell kommen wir zu dem Schluss, dass etwas nicht stimmen kann. Irgendwo her muss Sirius ja zumindest Thomas Daten haben und irgendwo her müssen die ja auch wissen, dass Thomas bei einer Tochter der Generali versichert war. Frau Haake verspricht, am Ball zu bleiben und weiter nachzuforschen.
Ein Tag vergeht – inzwischen ist Dienstag. Ich setze mich an den Rechner und recherchiere zur Sirius Inkasso GmbH. Neben der Webpräsenz des Unternehmens fördert die Recherche aber nur wenig Rühmliches zu Tage: Seitenweise Forenartikel sind zu lesen, in denen User sich über die Sirius Inkasso GmbH beschweren und diskutieren, was zu tun sei*.
Es ist Mittwoch, der 5. Mai 2010. Meine Anfrage an die Pressestelle der Generali in Köln liegt inzwischen auf dem Schreibtisch von Herrn Dr. Segal in München. Er ist Pressesprecher der dort niedergelassenen Generali Versicherungen (nicht zu verwechseln mit der Holding). Auf Nachfrage bei der Versicherung selbst ist zwar nichts erhellendes herausgekommen, aber Herr Dr. Segal hat Kontakt zur Sirius Inkasso aufgenommen und die übersendet ihm einen Scan.
Den bekomme ich aber noch nicht. Zu diesem Zeitpunkt wissen weder Thomas noch ich, dass es ein derartiges Dokument überhaupt gibt. „Um Ihre Fragen zu Herrn M. zu beantworten, brauchen wir aus datenschutzrechtlichen Gründen die ausdrückliche Zustimmung von Herrn M.“ schreibt er mir per Mail.
Mittwoch mittags rufe ich Thomas an. Der fasst ein Schreiben ab, in dem er die Generali Versicherung und all ihre Tochterunternehmen bevollmächtigt, mir Auskunft zu erteilen. Dieses Schreiben legt er aufs Fax und schickt es auf die Reise nach München.
Um 17.34 Uhr erreicht mich die Mail von Herrn Dr. Segal. Dort ist zu lesen:
Inzwischen haben wir von Herrn M. die Vollmacht erhalten, Ihnen uneingeschränkt Auskunft zu seinem Versicherungsverhältnis zu geben:
Zu zwei Verträgen von Herrn M. bei der Generali Versicherung (ehemals Volksfürsorge Sach) gibt es Außenstände. Hierbei handelt es sich um einen Kfz-Vertrag und einen Privathaftpflichtvertrag. Zu beiden Verträgen liegt ein Vollstreckungsbescheid vor, der nach 30 Jahren verjährt. Herr M. hatte auch Kontakt zur Firma Sirius, denn er hat am 8.12.2004 ein Ratenzahlungsangebot der Firma Sirius unterschrieben, das er jedoch nicht eingehalten hat (Dokument anbei).
Diese von Herrn M. angenommene Erklärung ging, wie das von Ihnen zitierte und offensichtlich bei Herrn M. angekommene Schreiben an die Bamberger Adresse.
Ich wundere mich. Ich rufe Thomas an. Er ist erschrocken – denn er kann sich nicht erinnern, jemals mit Sirius in Kontakt gestanden zu haben. „Das damals habe ich doch mit der Volksfürsorge ausgemacht“ sagt er. Und ist sich dabei nicht mehr ganz sicher.
Rückblende – 2004: Thomas steht mit beiden Beinen im Leben. Eines Tages aber entdeckt er einen kleinen festen Knoten unter der Haut. Er ist beunruhigt und geht zum Arzt. Die Diagnose steht schnell fest: Krebs. Thomas kommt schnell ins Krankenhaus, wird operiert. Danach beginnt die Chemotherapie, die ihn, wie er sagt, sehr mitnimmt, körperlich und seelisch. Thomas ist nicht arbeitsfähig, die starken Medikamente beeinträchtigen ihn sehr. Er kann drei Monate nicht zur Arbeit kommen, verliert seinen Job. Er ist auch nicht in der Lage, Arbeitslosengeld zu beantragen. Thomas lebt von seinem wenigen Ersparten, ist froh, die Medikamente zahlen zu können. Irgendwann erhält er ein Schreiben – er unterzeichnet und überweist einen geringen Betrag. Danach hört er nie wieder etwas von Sirius oder der Volksfürsorge, die seinen Versicherungsvertrag gekündigt hat.

Thomas beginnt sich im Jahr 2005 wieder zu erholen. Heute hat er den Krebs besiegt – aber zur jährlichen Kontrolluntersuchung geht er immer noch mit weichen Knien. Er hat eine neue Arbeitsstelle gefunden – er ist wieder im Innendienst angekommen. Drei Vertriebler hat Thomas heute unter sich, er ist Ausbilder geworden und entlässt heuer den ersten jungen Menschen in die Berufswelt. „Eigentlich“, so sagt Thomas, „ist das aus der dunklen Zeit so gut wie vergessen. Einiges habe ich sicher verdrängt und manches ist auch gar nicht so an mich herangekommen. Ich war damals ganz schön beinander während der Chemo“.
Thomas will an diese schwere Zeit nicht mehr erinnert werden. Am Donnerstag, den 6. Mai geht er zur Bank und überweist 262 Euro an die Sirius Inkasso GmbH.
Ist damit alles erledigt? An und für sich ist damit alles erledigt. Aber Fragen bleiben dennoch offen.
Ich treffe mich noch einmal mit Thomas. Wir ratschen ein wenig. Ich bitte ihn, noch einmal mit seiner Mutter in Bamberg zu telefonieren. Die sagt, dass nie Schreiben von einem Gericht gekommen seien, das wüsste sie, das hätte sie gesehen. Frau Müller ist eine liebenswerte, zuverlässige ältere Dame. Ich selbst glaube ihr. Damen wie Frau Müller wären zutiefst erschrocken, wenn plötzlich Gerichtspost im Briefkasten läge.
Zurück bleibt ein komisches Gefühl. Wie hoch die Forderung an Thomas war, nachdem er einige Raten zahlte, warum sich niemand bei ihm meldete, als er die Raten nicht mehr zahlte, warum er keine Post vom Amtsgericht erhielt, wie der Differenzbetrag von knappen hundert Euro von der ursprünglichen Forderung zum jetzigen „reduzierten“ Betrag, den die Sirius Inkasso GmbH einforderte überhaupt zustande kam, keiner kann das heute mehr sauber nachvollziehen oder richtig erklären.
Niemand weiß, warum die Sirius GmbH in ihrem Schreiben kein Aktenzeichen angegeben hat. Alles ist intransparent. Thomas hat es aufgegeben und gezahlt. Wahrscheinlich hätte er in einem Rechtsstreit oder Vergleichden den Betrag deutlich reduzieren können. Aber das will Thomas nicht. Es gibt wichtigeres im Leben als ein paar hundert Euro.
Niemand weiß, warum die Sirius Inkasso die Forderung von Ende Dezember 2004 bis Ende April 2010 (sic!) hat liegenlassen. Das sind über fünf Jahre! Niemand weiß aber auch, ob das Verhalten des Geschäftspartners der Generali Versicherung dazu geeignet ist, der Reputation ebendieses Hauses dienlich zu sein.
Das interessante Moment an dieser Sache ist, dass Thomas bei den ersten Telefonaten mit dem Hause Generali nichts in Erfahrung bringen konnte, was ihn hätte handeln lassen. Erst durch die Mail von Herrn Dr. Segal und nach telefonischer Rücksprache mit einem Fachteam der Volksfürsorge in Hamburg erfuhr er, dass zwar eine Vollstreckung vorgelegen haben muss, diese aber nie an ihn ergangen ist, weil die Post das Schreiben nicht zustellen konnte (sic!). Was wäre passiert, wenn ich nicht bei den Pressestellen täglich (außer Dienstag – sic!) nachgefasst hätte? Thomas war am Telefon äußerst hartnäckig. Und dennoch ist es ihm nicht gelungen, herauszufinden, was wirklich vorliegt.
Frau Haake und Herrn Dr. Segal habe ich per Mail gefragt, ob denn die Generali eine Geschäftsbeziehung mit der Sirius Inkasso unterhielten, ob es denn in ihrem Interesse sei, dass deren Schreiben so intransparent sind, ob sich noch niemand beklagt hätte?
Herr Dr. Segal antwortet:
Wie bereits mitgeteilt, stehen wir in Geschäftskontakt mit der Firma Sirius und haben ihr im Falle von Herrn M. wie üblich einen Vollstreckungsbescheid und die dazu notwendigen Daten zukommen lassen. Auch wenn unsere Geschäftsbeziehung zu Sirius bisher keinen Anlass zur Klage gab, danken wir Ihnen für Ihre Hinweise, die wir selbstverständlich prüfen und dann ggf. auch reagieren.
Ich bin auch bei einer Tochter der Generali versichert, habe bei der Aachen Münchener eine Haftpflichtversicherung und auch eine Advocard. Nun weiß ich, was passiert, wenn mir das Schicksal einmal übel mitspielt und ich die Versicherung nicht mehr zahlen kann. Mir ist richtig schlecht.
___________________
* Link, Link, Link, Link…