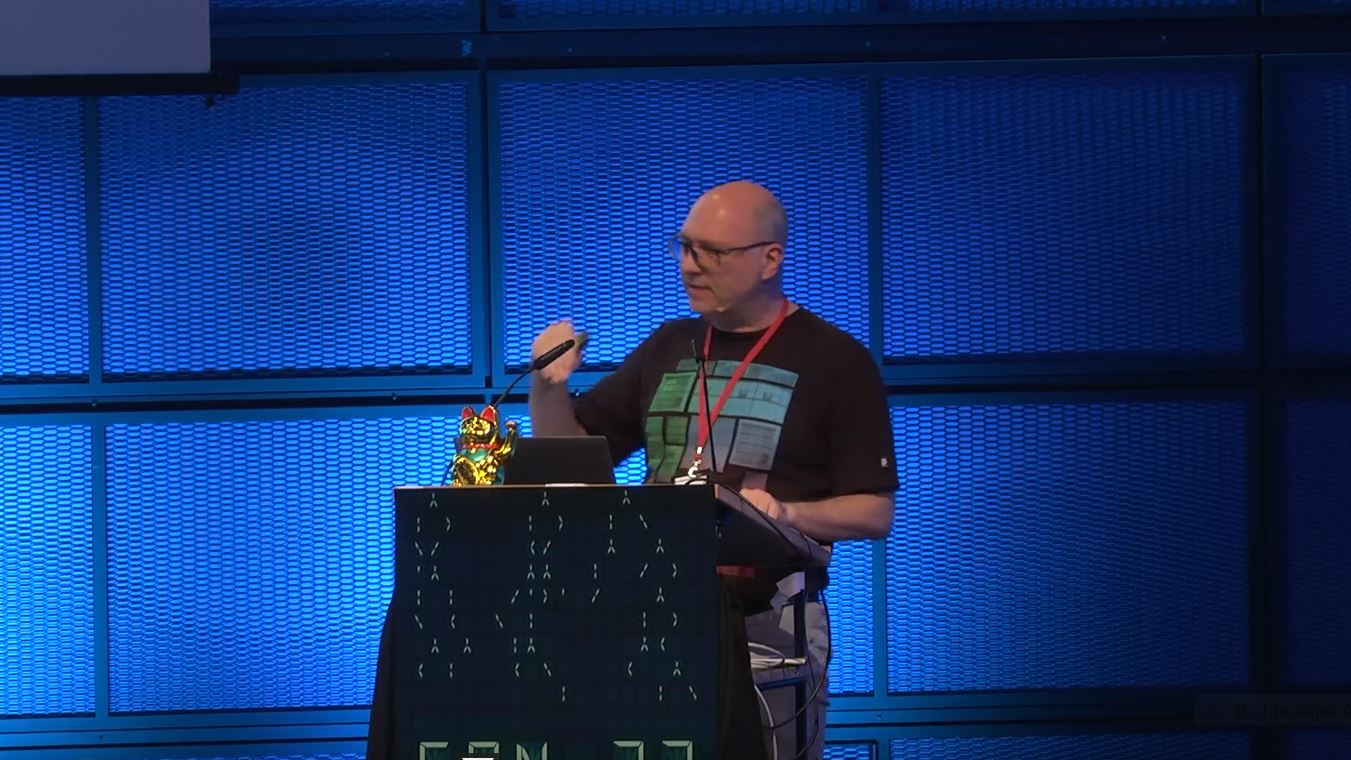Kommt die ePA-Pflicht?
Was wir gerade aus den Koalitionsverhandlungen zum Thema Gesundheit hören müssen, ist mehr als gruselig. Datenschützer haben uns längst über die Gefahren der elektronischen Patientenakte aufgeklärt, unsre Daten sollen „aggregiert“ (wer’s glaubt, wird selig) an alle möglichen Privatunternehmen verkauft werden, Lauterbach konnte mit seinen feuchten Träumen von einer triagierenden KI nicht hinter dem Berg halten.
Die Widerspruchslösung gegen die ePA ist schon für sich genommen eine Frechheit, in einer freiheitlichen Demokratie wäre ein bewusster Opt-in der Patienten die ausnahmslos einzige gangbare Möglichkeit gewesen – Daten ohne die aktive Zustimmung der Patienten zu sammeln und zu verkaufen, stellt eine außergewöhnliche Dreistigkeit dar.
Erwartungsgemäß machten, soweit das bekannt ist, nicht viele Patienten von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch, je nach Krankenkasse zwischen etwa einem und fünf Prozent der Versicherten. Wirklich belastbare Zahlen konnte ich hier leider nicht ausfindig machen – was ja für sich genommen schon bemerkenswert ist.
Der Zwang zur Datensammlung und Offenlegungen – wir kennen ihn von den Diktaturen dieser Welt – soll nach dem Willen der Koalitionäre auch die elektronische Patientenakte betreffen: Unter der Zwischenüberschrift „Elektronische Patientenakte soll mit Sanktionen starten“ berichtet das Deutsche Ärzteblatt:
„Noch 2025 rollen wir die elektronische Patientenakte stufenweise aus, hin von einer bundesweiten Testphase zu einer verpflichtenden sanktionsbewehrten Nutzung“, heißt es in dem Ergebnispapier. Zudem solle der Austausch zwischen den Versicherungsträgern und Ärztinnen und Ärzten vereinfacht werden.
Sauber! Die Integrität der intimsten Daten eines Menschen, der Gesundheitsdaten, wird in Zukunft nicht allein von der Informiertheit des Patienten, sondern auch von dessen Geldbeutel abhängen. Denn die Sanktionen, die drohen, muss man sich auch leisten können. Bereits im Gespräch waren höhere Eigenleistungen beim Krankenkassenbeitrag der GKV.
Erst zum Jahreswechsel demonstrierte der CCC, dass die ePA-Infrastruktur ziemlich unsicher ist, um es mal vornehm und zurückhaltend zu formulieren und resümiert, dass das „Vertrauen in die elektronische Patientenakte (ePA) derzeit nicht gerechtfertigt ist“. Die Versicherten in diese unsicheren Strukturen zwingen zu wollen und diejenigen, die sich diesem gewinnbringenden Zwang zu entziehen suchen, dafür zu bestrafen, ist mit dem Charakter einer freien Gesellschaft jedenfalls nicht zu vereinbaren.
Was wird passieren? Es steht zu erwarten, dass Menschen aus (der wohlgemerkt berechtigten) Furcht vor „Aktenkundigkeit“ und Diskriminierung bestimmte (tabuierte oder als tabuiert erlebte) Erkrankungen, den Gebrauch bestimmter Suchtmittel, bestimmte Prädispositionen dem Arzt verschweigen werden. Es steht zu erwarten, dass dann diese Erkrankungen nicht adäquat behandelt werden, dass die Erfolge von Therapien anderer Erkrankungen gefährdet werden oder die Therapien ohne ärztliche Kenntnis dieser Umstände den Patienten selbst gefährden. Die EPA wird also nicht nur das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient belasten, sie birgt eine konkrete Patientengefährdung.
Schon jetzt ist klar: Der Zwang, an der ePA teilzunehmen (und sei es auch nur ein „milder“ ökonomischer Zwang), wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Menschenleben kosten. Dass, wie die Befürworter der ePA argumentieren, selbe Menschenleben rettet, darf, wie wir gelernt haben, nicht erwartet werden. Zwar bürdet die elektronische Patientenakte den Ärzten und dem Praxispersonal umfangreiche Dokumentationspflichten auf (für die im Arbeitsalltag dieser Berufsgruppen bekanntermaßen kaum Zeit zur Verfügung steht und die somit für den Patientenkontakt fehlt), sie ist strukturell aber kaum geeignet, im Notfall schnell und vor allem aktuelle und relevante Daten zu liefern, die Auswertung der Daten ist für den Arzt in sinnstiftender Zeit kaum möglich und der Zweck der Karte bleibt fraglich – um den Preis des nicht gerade geringen Risikos eines Abflusses persönlichster Daten in Kanäle, in die sie nicht gehören.
Der Fakt, dass die zukünftigen Koalitionäre ein so massives Interesse an unseren persönlichsten Daten haben, dass sie nicht vor der Sanktionierung Millionen Versicherter zurückschrecken, sollte uns alle aufrütteln! Es ist nicht zu spät, der ePA zu widersprechen, es dauert mit dem Widerspruchsgenerator auf der Seite widerspruch-epa.de nur wenige Minuten (und der Widerspruch kann in der Zukunft selbstverständlich wieder zurückgenommen werden). Wer auf der sicheren Seite sein möchte, widerspricht – und die Sanktionen müssen erst einmal kommen! Je mehr Menschen widersprechen, desto schwieriger lässt sich eine Sanktion derer, die einen sorgsamen und bedachten Umgang mit ihren Daten pflegen, politisch durchsetzen.